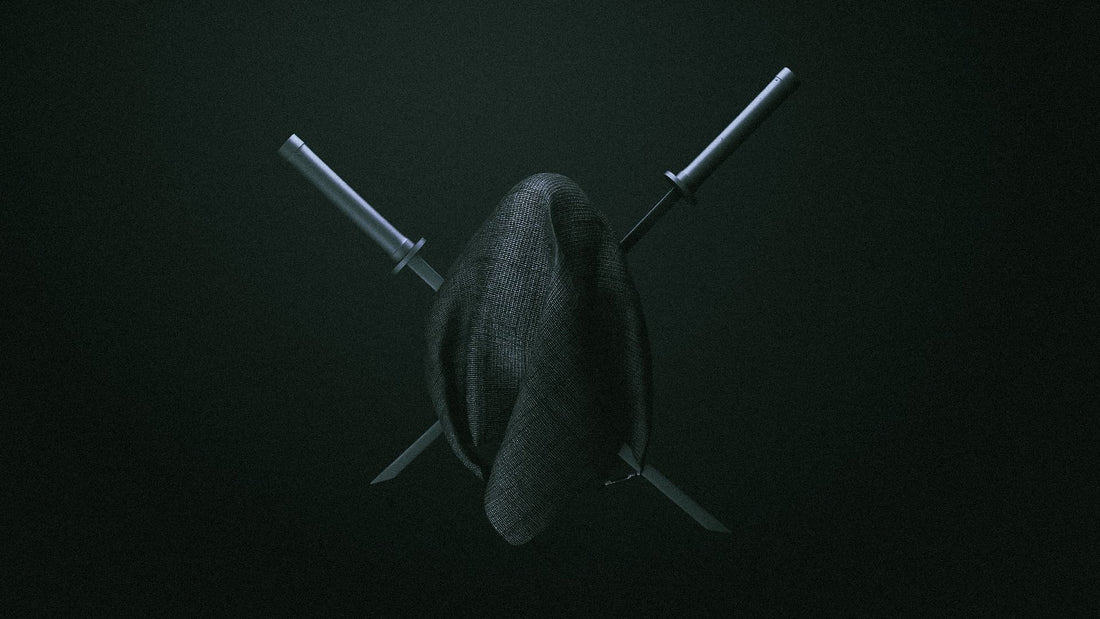
Kampf Couture
Durchschnittliche Lesezeit: 4-6 Minuten
Vor kurzem hat jemand ein Reel über die Ursprünge japanischer Workwear-Hosen und ihre Design-Wurzeln in europäischen Knickerbocker-Hosen gepostet. Das hat uns inspiriert ein wenig über die Entstehungsgeschichte des dōgi und anderer Kampfuniformen zu forschen. Was beeinflusste die Stoffwahl? Gibt es Gründe für einen bestimmten Schnitt oder Stil abseits des Aussehens? Warum tragen wir das, was wir beim Training tragen?
Genau wie sich Kampfkünste von kampfbereiten Fähigkeiten zu strukturierten Wegen der Selbstverbesserung entwickelten, verwandelten sich unsere Uniformen von einfacher Alltagskleidung zu dem, was wir heute tragen.
Ursprünge
Die Wurzeln der Kampfkunst-Kleidung reichen zurück zu den Feldern und Werkstätten Ostasiens, wo Prakmatismus das modische Bewusstsein antrieb. In Okinawa, dem Geburtsort des Karate, waren frühe Trainingsoutfits ziemlich genau das, was Bauern und Fischer täglich trugen. Diese robusten, schlichten Baumwollkleider waren hauptsächlich dafür gemacht, harte Farmarbeit zu bewältigen. Aber die Flexibilität und Stärke der Stoffe zeigten auch ihre Vorteile nach getaner Arbeit – beim Training im Dōjō.
In Chinas Shaolin-Tempeln trugen frühe Wushu-Praktizierende ihre Jiasha-Roben und Yifu-Kleider – die sowohl für das Klosterleben als auch für das Training geeignet waren. Die losen Ärmel und gewickelten Fronten beeinflussten später viele andere Kampfkleidung wie die traditionellen Kung Fu-Uniformen mit ihren Froschknöpfen und Mandarin-Kragen.
Kanōs Game Changer
Die größte Veränderung in der Entwicklung von Kampfkunst-Uniformen stellte sich in den 1880er Jahren ein, als Kanō Jigorō das Jūdō entwickelte. Er kombinierte traditionelle japanische Jujutsu-Techniken mit neuen pädagogischen Ideen und sah hierfür die Notwendigkeit eine standardisierte Ausrüstung zu entwickeln, die Hand in Hand mit seiner neuen Kampfkunst geht.
Der Judogi musste vor allen Dingen für die Wurf- und Bodentechniken robust genug sein. Die Wahl einer schlichten, weißen Baumwolle sorgte dafür, dass alle zusammen ohne Klassenunterschiede zusammen trainieren konnten. Althergebrachte Uniformen waren dafür ungeeignet.
Das Judogi-Design wurde schnell zum Standard für andere japanische Kampfkünste. Durch den regelmäßigen Austausch von Gichin Funakoshi und Kanō Jigorō übernahm Karate den Judogi und verlieh ihm seine eigene Note. Der Karate-Gi wurde leichter und weiter im Schnitt, um dem Fokus im Karate auf Schlag- und Tritttechniken gerecht zu werden.
Äußere Einflüsse
Obwohl der japanische Gi weltweit enormen Einfluss hatte, machten es andere Regionen auf ihre Weise. Chinesische Kampfkünste hielten an Teilen traditioneller Kleidung fest. Dort findet man vornehmlich Stoffe wie Seide und Satin, die noch heute zum Beispiel in Tai Chi oder modernem Wushu zu finden sind. Im FMA (Filipino Martial Arts) lag der Schwerpunkt traditionell auf praktischer Anwendung statt auf formalisiertem Training. Daher wird oft in Alltagskleidung trainiert, um Praktizierende auf reale Selbstverteidigungsszenarien vorzubereiten.
Umweltfaktoren haben Kampfoutfits ebenfalls geprägt – schwere Stoffe in kälteren Regionen und leichte Stoffe in feuchten und heißen Klimazonen wie die sarong-ähnlichen Kleidungsstücke indonesischer Pencak Silat-Kämpfer. Diese klimatisch bedingeten Faktoren beeinflussen nicht nur das, was getragen wurde, sondern auch wie sich Techniken und Bewegungen entwickeln. Diese können auch innerhalb eines Stils je nach Region der Schule aus diesem Grund variieren.
Die Harmonie zwischen Uniform und Technik erstreckt sich über eine Entwicklung über Jahrhunderte. Form und Funktion haben sich so durch das gesammelte Wissen von Generationen immer weiterentwickelt.
Danke fürs Lesen. Bleib neugierig!







